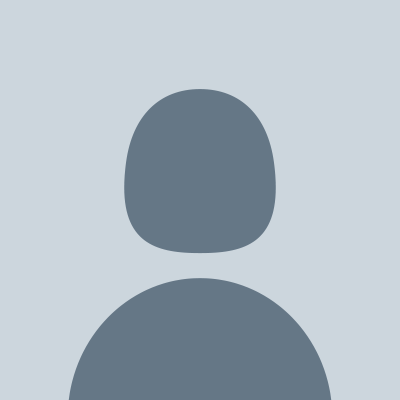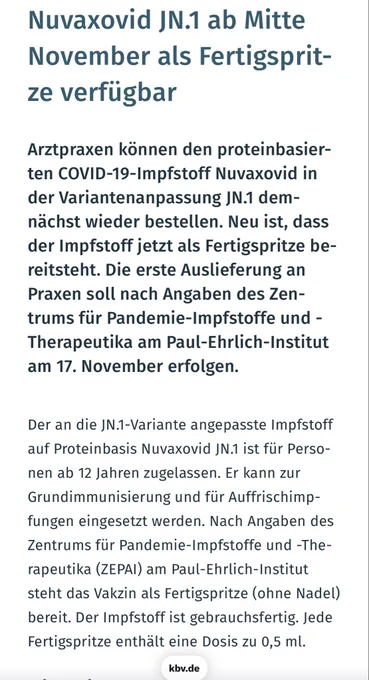Mag Katzen. In der Ukraine auch auf Gleisketten. RTs bedeuten nicht zwangsläufig Übereinstimmung
Lohnsburg am Kobernaußerwald,
Joined December 2013
- Tweets 154,126
- Following 7,495
- Followers 1,468
- Likes 230,381
Ralph W. Eisermann retweeted
Hier erklärt einer wie er ein echtes Köderpaket gebaut hat. Mit Glitter, Stinkbombe, GPS und Videoaufzeichnung der Überraschung: twistedsifter.com/videos/gli…
Ralph W. Eisermann retweeted
Für Millionen Menschen in der Ukraine ist es dunkel und kalt. Ab jetzt 16 Stunden täglich ohne Strom. Große Teile der Stromproduktion sind beschädigt oder zerstört, dazu ein Fünftel der Heizkapazitäten. Europa hat Russland gewähren lassen. 1/3
Ralph W. Eisermann retweeted
Die #AfD sagt, sie sei nicht verfassungsfeindlich, aber wenn Steinmeier sagt: „Verfassungsfeindliche Parteien dürften sich nicht wundern, wenn sie verboten werden“, ruft die AfD ganz laut: „Huhuhu👋, hier, hier, wir, huhu, der Steinmeier will uns verbieten.“🤔 #FaszinierendesEingeständnis
Ralph W. Eisermann retweeted
Wann werden Journalisten endlich die Schweinereien der SVS aufdecken?
@SchumannKorinna, es ist höchste Zeit, diesen Sauhaufen aufzuräumen.
@florianklenk @ArminWolf @corinnamilborn
Ralph W. Eisermann retweeted
Nach 1967. Verteidigungsminister Moshe Dayan, der nach dem SinaiFeldzug auch »Dschingis-Kohn« genannt wurde, sucht bei US-Präsident Johnson um Waffenlieferungen für Israel nach. Sagt Johnson: »Ihr könnt gerne Waffen haben, aber dafür erbitten wir uns eine Gefälligkeit. Wie ihr wisst, führen wir gerade Krieg in Vietnam. Ihr könntet uns mit ein oder zwei Bataillonen symbolisch beistehen.« »Ein, zwei Bataillone! Wollt Ihr China erobern?«
Ralph W. Eisermann retweeted
tagesschau.de/wirtschaft/unt…
"Die Regulierungsflut aus Berlin und Brüssel ist für unsere Branche das Schlimmste am Standort - noch vor Energiepreisen und Steuern."
Ralph W. Eisermann retweeted
Heute findet die 8. Sitzung der Corona Enquete-Kommission statt zum Thema
„Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen und Umgang mit Langzeitfolgen
(Long-Covid/Post-Vac)“
mit live Übertragung:
bundestag.de/ausschuesse/wei…
Ralph W. Eisermann retweeted
AUTSCH
Trump wurde so krass nieder gebuht, wie ich es noch nie gesehen habe.
Mit so etwas kann er definitiv nicht umgehen.
Ralph W. Eisermann retweeted
Die russische Eroberung oder nach russischen Verständnis „Befreiung“ der Ostukraine ist in Wahrheit Vertreibung und Zerstörung. Putin produziert Hunderttausende Tote, Millionen Flüchtlinge, Geisterstädte und Ruinen.
Ralph W. Eisermann retweeted
Betrieb mit geretteten Lebensmitteln – oder: Wenn gute Absicht und Realität kollidieren
Ein grauer Morgen, irgendwo in einem unscheinbaren Gewerbegebäude am Rande der Stadt. Von außen sah es aus wie eine alte Bäckerei, drinnen aber summten Edelstahlmaschinen, es roch nach Tomaten, Gewürzen und leicht säuerlichem Dampf. Die Luft war warm, feucht, durchzogen von einem Hauch Restbrot und Orangenschalen – Reste der letzten Produktion.
Wir waren ein kleines, zusammengewürfeltes Team: ehemalige Köche, Quereinsteiger, Sozialhilfeempfänger, Menschen in Wiedereingliederungsprogrammen. Einer hatte früher in einem Sternehaus gearbeitet, eine andere kam aus der Pflege und wollte „endlich mal was mit den Händen machen“. Und mittendrin: der Chef – Mitte fünfzig, leicht gehetzter Blick, immer ein Telefon am Ohr, ständig zwischen Idealismus und Excel-Tabellen gefangen.
Unser Auftrag: aus geretteten Lebensmitteln neue Produkte herstellen. Nachhaltig, sinnvoll, lokal.
Zum Glück wurde das Projekt teilweise von der Stadt finanziert – die mochten solche Projekte für ihre Statistiken.
Und wenn am Ende noch ein paar Gläser Pastasauce für Restaurants raussprangen, war die Welt in Ordnung.
An dem Tag stand „Spaghetti all’amatriciana“ auf dem Plan.
Ein halber Schweinebauch lag auf dem Tisch, glänzend, mit feinen Fettadern durchzogen. Wir schnitten, brieten, rührten. Zwiebeln, Tomaten, Gewürze, ein Schuss geretteter Weißwein.
Stundenlang köchelte die Sauce – der Duft war umwerfend.
Es fühlte sich fast an wie in einer echten Restaurantküche, nur dass wir mit Lebensmitteln arbeiteten, die anderswo längst im Container gelandet wären.
Kurz vor Feierabend, als alle müde waren und die Wände vom Dampf leicht klebrig glänzten, kam jemand auf die Idee:
„Lass uns die Sauce über Nacht im Combisteamer garen. Langsam, sanft, dann ist sie morgen perfekt.“
Gesagt, getan.
Mehrere Kilo Sauce wurden in große Edelstahlbehälter gefüllt, sorgfältig mit Alufolie abgedeckt, Deckel drauf, Temperatur eingestellt.
Es roch nach Erfolg – nach Sinn.
Am nächsten Morgen, kurz nach sieben.
Noch bevor der erste Kaffee fertig war, kam der Schreck.
Einer der Kollegen öffnete den Steamer – und ein beißender metallischer Geruch schlug ihm entgegen.
Die Folie hatte sich aufgelöst, kleine silberne Partikel schwammen auf der Oberfläche der Sauce.
Ein feiner Glanz, fast schön – wäre er nicht toxisch gewesen.
Der Chef kam mit hochrotem Kopf, Handy am Ohr, schwitzend.
„Ja, hallo, Giftnotruf? Wir haben da… ähm… Aluminium in Tomatensauce.“
Sein Blick wechselte zwischen Panik und Verzweiflung.
„Wie viel? Na ja, so… 80 Liter vielleicht.“
Ein kurzer Moment Stille, dann nickte er nur.
„Ja. Alles entsorgen. Komplett.“
Niemand sagte etwas.
Wir schauten auf die Behälter, in denen noch vor Stunden unser ganzer Stolz geschmort hatte.
Ein dumpfes „Platsch“, als der erste Eimer im Müll landete.
Mehrere hundert Franken Produktionskosten – einfach weg.
Und doch: niemand machte Vorwürfe.
Wir wussten alle, dass Fehler dazugehören.
Vor allem, wenn man mit dem arbeitet, was andere wegwerfen.
Später saßen wir beim Mittagessen, Brot mit Restpesto, die Stimmung still.
Der Chef sah müde aus, aber er lächelte.
„Seht’s positiv. Jetzt wissen wir wenigstens, dass Alufolie und Tomaten keine Freunde sind.“
Und so endete der Tag, wie er begonnen hatte:
mit einem Hauch von Idealismus –
und dem festen Glauben, dass Scheitern nur eine andere Form von Lernen ist.
Ralph W. Eisermann retweeted
Auf geht’s. Praxen durchtelefonieren, Impftermin klarmachen.
#Novavax #Nuvaxovid #Covid #Impfung
kbv.de/praxis/tools-und-serv…
Ralph W. Eisermann retweeted
Hören Sie doch auf! Natürlich hatte Trump zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen. Er hatte diesen auch geplant und finanziert. Der Zusammenschnitt der BBC war nicht gut, aber so zu tun, als ob hier ein falscher Eindruck entstanden ist, das ist nicht richtig.
A few reminders of what Trump said in the lead up to Jan 6th
December 19th: “Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!”
December 26th: “We will never give up. We will never concede.”
December 27th: “Just say the election was corrupt and leave the rest to me and the Republican congressmen.”
December 30th: “We’re going to fight like hell. If you don’t fight, you’re not going to have a country anymore.”
December 31st: “We’ve won this election. They just don’t want to admit it. We’ll see what happens on January 6th….The people are angry.”
Jan 3rd: “They’re not taking this White House. We’re going to fight like hell.”
Jan 4th: “If the Democrats take control, we’re not going to have a country anymore… You have to get your people to fight.”
Jan 5th: “Washington is being inundated with people who don’t want to see an election victory stolen. Our country has had enough, they won’t take it anymore!”
On Jan 6th itself Trump over roughly 70 minutes used the words “fight”, “fighting” or “fighters” more than 20 times.
Ralph W. Eisermann retweeted
BREAKING
Ukrainian partisans assassinated Kirill Grekov, the Russia-appointed deputy prosecutor general of occupied Luhansk.
🇺🇦🇷🇺
Ralph W. Eisermann retweeted
Dittert hat Recht. 6 Jahre nach dem Kapitolsturm einen Zusammenschnitt zu kritisieren, ist ein populistischer Angriff auf die BBC, den sie nun leider verloren hat. Der Schnitt war unglücklich, doch Trump wollte den Angriff. Der Gesamteindruck war richtig.
A few reminders of what Trump said in the lead up to Jan 6th
December 19th: “Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!”
December 26th: “We will never give up. We will never concede.”
December 27th: “Just say the election was corrupt and leave the rest to me and the Republican congressmen.”
December 30th: “We’re going to fight like hell. If you don’t fight, you’re not going to have a country anymore.”
December 31st: “We’ve won this election. They just don’t want to admit it. We’ll see what happens on January 6th….The people are angry.”
Jan 3rd: “They’re not taking this White House. We’re going to fight like hell.”
Jan 4th: “If the Democrats take control, we’re not going to have a country anymore… You have to get your people to fight.”
Jan 5th: “Washington is being inundated with people who don’t want to see an election victory stolen. Our country has had enough, they won’t take it anymore!”
On Jan 6th itself Trump over roughly 70 minutes used the words “fight”, “fighting” or “fighters” more than 20 times.
Ralph W. Eisermann retweeted
Zoster schlägt auf die Gefäße: Wie schon beim Schlaganfall fiel die Risikosteigerung bei den bis zu 40-Jährigen noch deutlicher aus: Die TIA-Rate war 2,4-fach, die Herzinfarktrate 1,5-fach erhöht. aerztezeitung.de/Medizin/Zos…
Ralph W. Eisermann retweeted
Die #AfD fordert, den 9. November zum Feiertag zu machen. Ich bin der Meinung, dass sie insgeheim die Pogrome von 1938 feiern und fortführen wollen. Alles, was nicht kartoffelig genug ist, soll vergrämt oder deportiert werden. Sie nennen es „Anreize zur Remigration”.
Ralph W. Eisermann retweeted
Die #Union zum #CanG #MedCanG
Es ist die reine Boshaftigkeit, anders ist das nicht mehr zu erklären @ninawarken @BMG_Bund
"Daten statt Panik — die Zahlen rechtfertigen keine Rückkehr zur Massenkriminalisierung"
100.000 weniger Strafanzeigen — und trotzdem will die Union Cannabis wieder stärker kriminalisieren. Eine Zwischenbilanz der Unis Hamburg, Düsseldorf und Tübingen unter Jakob Manthey sagt klar: kurzfristig „ziemlich wenig passiert“, kein dringender Handlungsbedarf.
Fakten: 2024 konsumierten rund 5 Mio. Menschen Cannabis, die Mehrheit gelegentlich; etwa 1 Mio. nahezu täglich. Jugendkonsum scheint leicht zu sinken, keine drastische Zunahme von Suchterkrankungen oder Verkehrsunfällen.
Politiker fordern Verschärfungen trotz fehlender Evidenz. Für Dich als verantwortlichen Konsumenten bleibt die Schlussfolgerung präzise: Daten statt Panik — die Zahlen rechtfertigen keine Rückkehr zur Massenkriminalisierung.